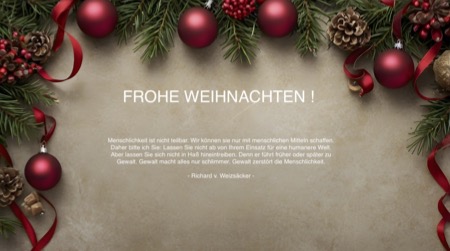„Wenn ich nicht für mich bin, wer ist für mich?
Und solange ich (nur) für mich selbst bin, was bin ich? Und wenn nicht jetzt, wann denn?“
Rabbi Hillel
Rabbi Hillel prägte durch seine Lehre nicht nur das Judentum maßgeblich, sondern verwies durch diese Aussage auf den wesentlichen Inhalt der Tora, die Goldene Regel. Die darin enthaltene Nächstenliebe und Gewaltlosigkeit sind für das Verständnis unserer Ethik bis heute grundlegend.
In einer Zeit, in der die Demokratie unseres Landes durch Gleichgültigkeit und Polarisierung innerhalb der Zivilbevölkerung fragil geworden ist, ist es umso wichtiger, diese Werte zu wahren. Die Gemeinschaft der Zukunft, in der wir alle leben wollen, benötigt eine Achtung der Würde des Einzelnen sowie gelebte Solidarität.
Da wir alle Teil dieser einen Verantwortungsgemeinschaft sind, die den gemeinsamen Willen in sich trägt, Mitmenschlichkeit zu schützen und die Rechte eines jeden einzelnen Menschen zu bewahren, erwächst daraus auch für die junge Generation eine besondere Verantwortung: Die Erinnerungen an die Verbrechen des NS-Regimes nicht verloren gehen zu lassen.
Bereits zum 11. Mal fand vom 17.-22. Februar 2025 die Gedenkstättenfahrt der Georg- Christoph-Lichtenberg-Schule nach Auschwitz statt, an der 43 SchülerInnen der Jahrgänge Q4 und Q2 sowie drei Lehrkräfte teilnahmen.
Nachdem wir – Kassel bereits seit elf Stunden Busfahrt hinter uns lassend – in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim (Auschwitz) ankommen, ist trotz der bevorstehenden Programmpunkte die Leichtigkeit noch spürbar. Manche spielen Kicker (LehrerInnen gegen SchülerInnen), andere verausgaben sich beim Tischtennis, Werwolf oder ruhen sich auf den Zimmern aus.
Bereits am ersten Tag starten wir frühmorgens bei eisiger Kälte und Sonnenschein zum Stammlager I, wo wir von erfahrenen Guides durch das ehemalige KZ geführt werden. Uns allen ist es unwohl und das Grundgefühl ist beklemmend, als wir das Eingangstor durchschreiten, wohlwissend, dass für unzählige Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma sowie politische Gefangene ebendieses Tor nur einmal durchschritten werden konnte.
Dass manche Menschen dort Selfies von sich machen, können wir nicht begreifen.
Die Leichtigkeit vom Vorabend ist verflogen. Beim Anblick der 2000 Kilogramm verknoteten Haare laufen uns die Tränen. Wie viele Leben! Wir sehen Brillen, Unmengen an Schuhen, Koffern, Geschirr. Alle erzählen sie eine Geschichte, alle gehörten sie einem Menschen, einer Identität. Einer, die es nicht mehr gibt. Wir verlassen das Lager durch Gaskammer und Krematorium. Draußen brauchen wir alle eine Weile, um das zuvor Erlebte zu begreifen.
Die Fahrt nach Auschwitz-Birkenau (Stammlager II) am Folgetag verdeutlicht uns eindrücklich die Dimensionen des Vernichtungslagers und die dahinterstehende Tötungsmaschinerie.
Dort, wo von 1943 bis 1945 an der „Judenrampe“ die Selektionen stattgefunden haben, Eltern von Kindern getrennt wurde, Frauen von Männern; dort, wo viele noch hoffnungsvoll und ohne Angst den SS-Kommandanten in die Gaskammern gefolgt sind, dort stehen wir heute.
Das auszuhalten ist schwer.
Auch wenn vor Ort teilweise nur noch Ruinen sichtbar sind, da die Nationalsozialisten die Spuren des Vernichtens zu verwischen versuchten, entstehen durch die Erzählungen und Berichte der Guides dennoch Bilder vor unseren Augen, die wir so schnell nicht vergessen werden. Am Vorabend schauten wir „Schindlers Liste“ und die Erinnerung an die Szenen des Films flackern vor unseren Augen auf. Das Lager, die Baracken, die hohen Stacheldrahtzäune, all das erkennen wir wieder. In diesem heute leeren Lager ertönen in unseren Köpfen die Stimmen derjenigen, die damals versucht haben, hier zu überleben.
Wir legen Steine nieder: Auf den Ruinen der Gaskammern, an der „Judenrampe“, am Ascheteich.
Wir wollen nicht vergessen.
Das diesjährige Programm in Oświęcim und Krakau ermöglichte es den SchülerInnen, durch den individuellen Besuch der Länderausstellung im Stammlager I sowie die Stadtbesichtigungen in beiden Städten, einen differenzierten Blick sowohl in jüdisches Leben als auch die Geschichte Polens zu erhalten. Der Besuch zweier Synagogen und jüdischer Friedhöfe, der „alten Judenrampe“ und dem Besuch des Schindler-Museums in Krakau, boten weitere Möglichkeiten, um sich zu erinnern, zu lernen und zu reflektieren, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Die Rückmeldungen der SchülerInnen bringen zum Ausdruck, wie wichtig für sie die authentische Begegnung mit einem zentralen Ort des Holocausts war. Auch die allabendlichen Gesprächsrunden, die als sehr positiv und bereichernd empfunden wurden, gaben Raum für Reflexion und um sich über das Erlebte auszutauschen.
Die Recherche von und Auseinandersetzung mit Zeitzeugenberichten aus der Bibliothek der Internationalen Jugendbegegnungsstätte gaben ihnen die Möglichkeit, sich den Erinnerungen Überlebender anzunähern, deren Geschichten zu lesen und in eine Zukunft zu tragen, damit sie nicht verloren gehen.
Der letzte Abend. Die Woche belastet uns unterschiedlich stark. Wir reden viel miteinander. Über die Geschichte, die Schicksale, über uns und über die Zukunft.
Uns war klar, wir würden Auschwitz anders verlassen, als wir fünf Tage zuvor angereist waren. Verändert. Vor Ort waren wir konfrontiert mit einem Welt- und Menschenbild, das wir verabscheuen.
Uns ist klar, dass wir eine Aufgabe haben, aber wir sind mutig genug, um sie anzugehen.
L ́Chaim!